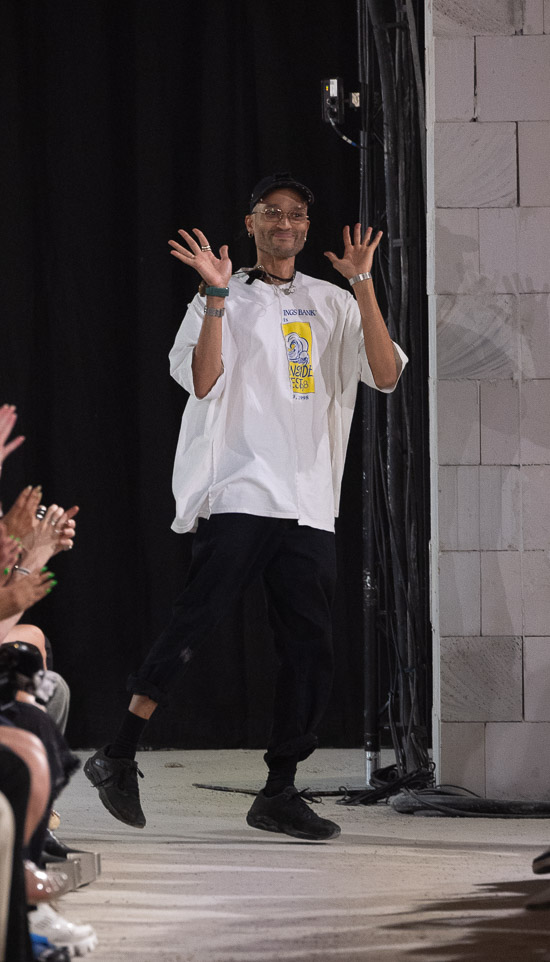Berlin Fashion Week SS2026 – FÜRST
Bilder: Andreas Hofrichter
Text: Gerhard Paproth
Die Selbstreflexion der Modemacher zum Stand der Dinge in der globalen Branche hat zu einem eigenen Darstellungsmodus ihrer Labels geführt, der nun selbst Mode geworden ist. Mit Buzigahill ist in diesen Kontext jetzt ein weiteres Label hinzu getreten, das, wie auch schon Palmwine Icecream, Probleme des afrikanischen Kontinents besonders akzentuiert herausstellt. Denn dort lädt die westliche Welt ihren gebrauchten Fast-Fashion-Schrott en masse ab und zeigt gerade damit die verwerfliche Marktpolitik ihrer Produzenten am penetrantesten.
Dass dieser Reflex afrikanischer Modemacher nun auf der Fashionweek in Berlin eine besondere Bühne bekommt, verweist auf das relevante Bewußtsein und die große Bedeutung, die dem ökologischen Aspekt der Mode hier zugewiesen wird und unterstreicht das politische Anliegen der jungen Modewelt auf das sinnfälligste.
Buzigahill ist das Label für eine kollektive Produktion in Uganda (und darüber hinaus reichend) mit der Absicht, Textilkolonialismus, Ownership und Rückgewinnung in seinem Herstellungsprozess als gesellschaftspolitisches Statement vorzuführen. Nachweise zu (und an) jedem Kleidungsstück zu seiner Herkunft, Beschaffenheit und seinem Produktionszeitraum werden wie ein Pass mit einer Identitätsnummer dokumentiert und in einem kleinen Infoheft detailliert aufgelistet. So bringt das Vorgehen den Modeschrott aus Europa, Nordamerika oder Asien klug und innovativ aufbereitet wieder zurück in sein altes, westliches Umfeld (Return to Sender), versehen mit Hinweisen, die der erneuten Nutzung auch ein erneutes, erweitertes Bewußtsein hinzufügt.
Die gesellschafts- und systemkritische Grundlage dieser Modeschöpfung wird bei Buzigahills Schau von Anfang an durch einbettende Inszenierung ins Bewußtsein gerückt, mit beginnender Stille, eingelesenen Passagen aus der UN Menschenrechtserklärung in 17 Sprachen, endend mit dem Satz „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren“, mit Infomaterial und nicht zuletzt einem gewählten Publikum.
Die Produktionen der Looks sind sehr vielfältig und komplex angelegt – handgefertigte Patchworks, traditionelle Stickkunst eines Kollektivs aus 46 süd-sudanesischen Frauen im Bidi Bidi-Flüchtlingscamp und viele weitere überraschende Kombinations- und Upcycleverfahren in Material und Aufbereitung geben den Outfits einen Background, der sich als entscheidender Aspekt dieser Mode versteht. Und der auch vorführt, dass nicht ein Lieferkettengesetz, ein wenig Upcycling oder neue Ökomaterialien schon alles ist, was hier neu gedacht werden muss. In dieser Hinsicht ist diese Schau auf der Berliner Fashionweek einer der wichtigsten und überzeugendsten Beiträge.
In anderer Hinsicht, nämlich der ästhetischen Prägung – für sich und auch fürs Ganze – genommen, bleibt vieles noch offen, denn deutlich gemachte gesellschaftspolitische Positionierung ist noch kein ausreichender ästhetischer Modus. Zudem sieht man den Sachen ja auch nur gelegentlich an, was dahinter steckt. Das Erscheinungsbild der ursprünglichen Teile, meistens ja Streetwear, ihre modischen Codes und die materialgeprägte Sportlichkeit erscheinen oft ungebrochen beziehungsweise repetiert wieder, sei es in den seitlich offenen, geknöpften, dünnen Hosen oder in den aufgeduckten Sprachfetzen (BIG, Try Jesus, Easy Love) und Signets (Addidas-Steifen, Nike-Haken, Labelnamen). Auch mit den üblichen Schichtungen, Dekonstruktionen und Mixturen entsteht letztlich noch kein eigener visueller Style, der eine Unverwechselbarkeit des Labels herausarbeitet und auch eine dazu gehörende formale Neupositionierung anstrebt. Es gibt zwar schon einige Besonderheiten, wie zum Beispiel den Denim Faltenrock und ein paar andere Pfiffigkeiten, aber viel eher findet man wieder, was man schon anderswo gesehen hat und vor allem viele Hässlichkeiten der amerikanischen Streetwear, inklusive baumelnder Shorts, tief hängender Hosenbünde (nun mit Unterhosenabschnitt fertig vernäht), fetter Prints und batikgefleckter Jeansjacken, bleiben Teil (manchmal auch Grundlage) der Gesamtästhetik. Hier sind die zutiefst negativen, proll-ästhetischen Standards der Fast-Fashion-Modewelt nicht analog zu den negativen Prozessen ihres Produktionssystems reflektiert. Dabei sind sie auch Teil dessen. Und diese Erscheinungsbilder wollen wir doch eigentlich ebenfalls nicht mehr. Nun, das ist vielleicht der zweite Schritt, auf den man noch warten muss.